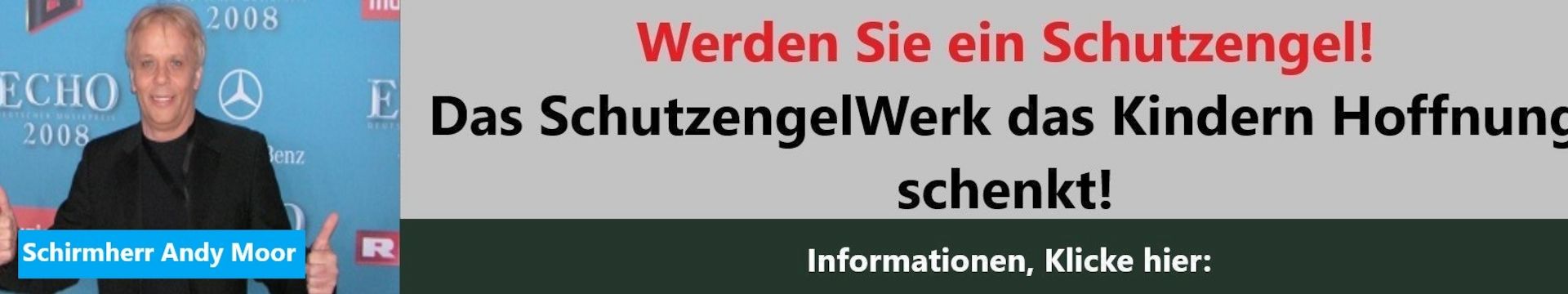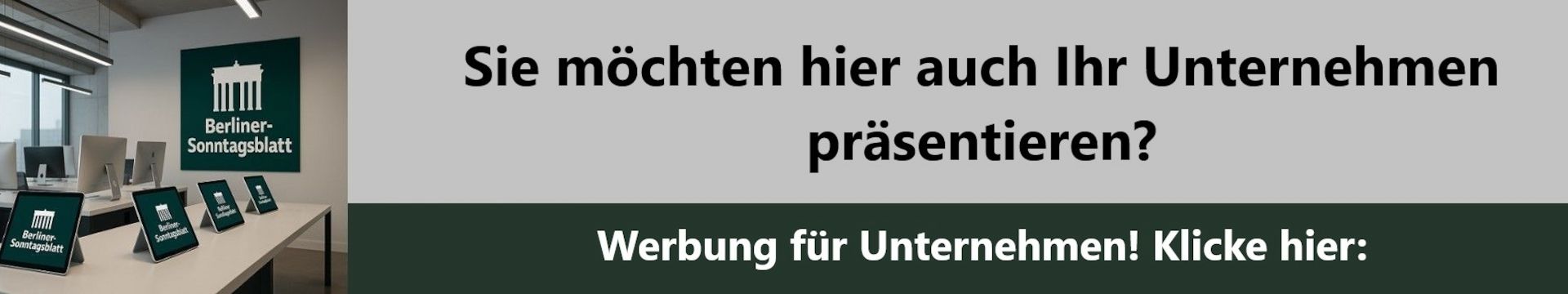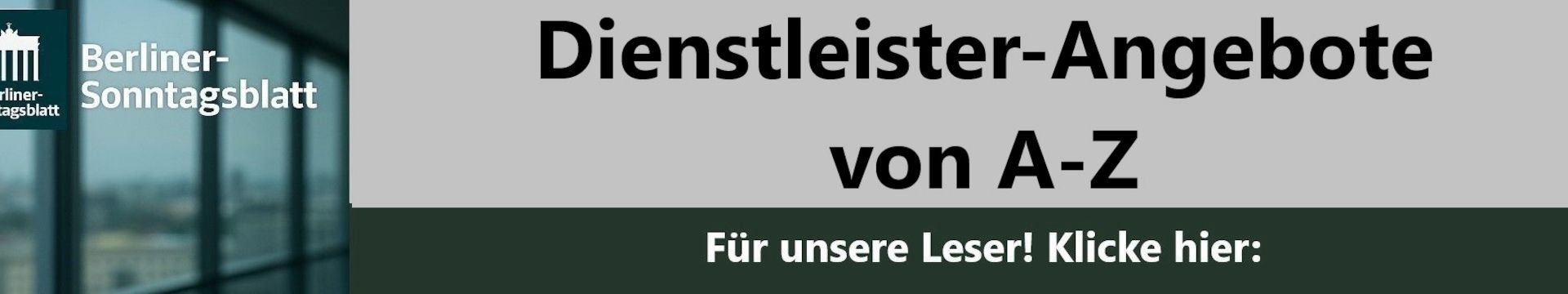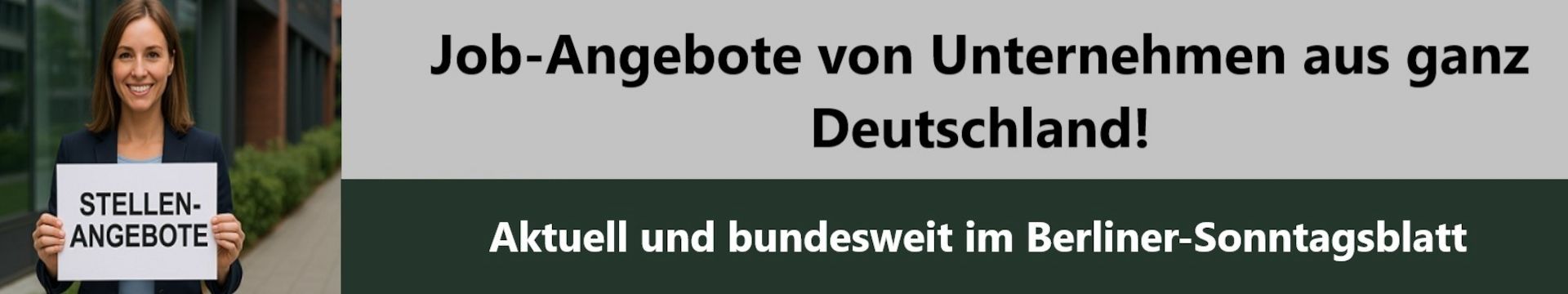Die Berliner Kultur steht unter Druck – allein im Land Berlin müssen in diesem Jahr 130 Millionen Euro eingespart werden, weitere 110 Millionen stehen für das nächste Jahr im Raum. Was also tun? In Studio 14 des rbb diskutierten führende Stimmen aus Kulturinstitutionen, Festspielbetrieb und privatwirtschaftlicher Veranstaltungswelt im Rahmen des Hauptstadtkulturgesprächs des VBKI über Wege aus der Finanzierungskrise – etwa mithilfe privater Mittel aus Sponsoring, Mäzenatentum und Förderkreisen. Das Hauptstadtkulturgespräch findet statt in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der Freunde der Akademie der Künste und rbb radio 3.
Kultur als Betriebssystem einer Gesellschaft
Gleich zu Beginn setzte Prof. Dr. Stephan Frucht, Vorsitzender des VBKI-Kulturausschusses und Künstlerischer Leiter des Siemens Arts Program, einen Ton, der sich durch den gesamten Abend ziehen sollte. Kultur, so Frucht, sei weit mehr als ein Haushaltsposten. „Kultur ist keine App, Kultur ist ein Betriebssystem“, sagte er – und plädierte für neue Denkweisen und steuerliche Anreizmodelle nach internationalen Vorbildern. In Indien lasse sich ein Teil der Steuerlast über Kulturzuwendungen verrechnen, in Brasilien sogar ein Teil der Einkommensteuer direkt an Kulturprojekte umleiten. Wenn die öffentliche Hand an Grenzen stößt, müsse man mutiger über private Beteiligungen sprechen, ohne die Verantwortung des Staates aus den Augen zu verlieren.
Salzburg als Vorbild: Partnerschaften statt Logos
Dr. Kristina Hammer, Präsidentin der Salzburger Festspiele, zeigte am Beispiel ihres Hauses, wie erfolgreich ein ausgewogener Finanzierungsmix sein kann. Ein Rekordergebnis von 256.000 Gästen in diesem Jahr und 98,3 Prozent Auslastung seien nur möglich, weil öffentliches Geld, Ticketerlöse und private Unterstützung ineinandergriffen. Doch Sponsoring erschöpft sich für Hammer nicht in Sichtbarkeit gegen Geld: „Es geht nicht darum, einen Namen irgendwo draufzukleben“, betonte sie. Was Salzburg auszeichne, sind langfristige Partnerschaften, aufgebaut auf Vertrauen, gemeinsamen Werten und dem Respekt vor der Freiheit der Kunst.
Mit Leidenschaft sprach sie über die Verantwortung, junge Menschen für die Kultur zu begeistern. Mobile Bühnen, Opernproduktionen für Schulen und direkte Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern seien entscheidend, um Schwellenängste abzubauen. Kinder und Jugendliche wolle man nicht schonen, sondern fordern und überraschen – denn Begeisterung entstehe dort, wo Kunst unmittelbar erfahrbar wird.
Strukturelle Unterfinanzierung trotz großer Summen
Prof. Marion Ackermann, Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, öffnete den Blick in eine Realität, die hinter den großen Häusern oft übersehen wird. Trotz beeindruckend wirkender Budgets seien die Museen strukturell unterfinanziert. „Für 21 Museen hatten wir jahrelang ein Ausstellungsbudget von nur 1,7 Millionen Euro“, erklärte sie.
Ackermann warb für ein neues Gleichgewicht zwischen öffentlichen Mitteln, Ticketerlösen und privaten Zuwendungen. Eine gesunde Balance könne entstehen, wenn die Erlösquellen zu jeweils einem Drittel zum Gesamtetat beitrügen.
Ihr Plädoyer für streitbaren Dialog wurde besonders aufmerksam aufgenommen: Kulturelle Debatten seien in Deutschland vielerorts zu zahm geworden. Dabei brauche es gerade heute die Kraft, Unbequemes zu thematisieren und gesellschaftliche Fragen offen zu thematisieren.
Relevanz statt Gratis-Kultur
Wie wichtig inhaltliche Relevanz für die Zukunftsfähigkeit von Kultur ist, verdeutlichte Prof. Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin. Sein Haus erreicht 800.000 Besucher im Jahr, 60 Prozent davon junge Erwachsene. Für Vogel ist klar: Relevanz schlägt Kostenloskultur. Studien zeigten, dass freier Eintritt selten jene erreiche, die man eigentlich gewinnen wolle. Entscheidend seien Orte, die Menschen zum gemeinsamen Denken einladen – Museen als Resonanzräume, nicht als Konsumangebote.
Mit einem Vergleich, der für viele im Raum ein Aha-Moment war, rückte Vogel kulturelle Wertigkeiten zurecht: Ein Familienausflug ins Blockbuster-Kino – „beispielsweise zu einem Dino-Film“ – koste inklusive Popcorn und Getränke schnell 150 Euro, ein Besuch im Naturkundemuseum für besagte 5-köpfige Familie gerade mal 15 Euro. Kultur dürfe sich nicht unter Wert verkaufen.
Privatwirtschaft: Marktlogik und Verantwortung
Für einen Kontrapunkt sorgte Andreas Schessl, Geschäftsführer der MünchenMusik Gruppe. Sein Betrieb finanziert sich vollständig aus Ticketerlösen – ein Modell, das Freiheit ermöglicht, aber auch harte Marktrealitäten kennt. Schessl warnte eindringlich davor, Ticketpreise künstlich niedrig zu halten oder massenhaft Freikarten zu vergeben. Damit schade man nicht nur den privaten Veranstaltern, sondern auch der langfristigen Wertschätzung von Kultur.
Seine zentrale Botschaft: Das Publikum müsse früh an klassische Musik herangeführt werden. „Stand heute erwarten wir, dass sich jemand ein Buch kauft, ohne lesen gelernt zu haben“, sagte er – und sprach sich für deutlich mehr Investitionen in kulturelle Bildung aus.
Junge Zielgruppen: Fordern, einladen, beteiligen
Überraschend einig war sich das gesamte Panel beim Blick auf die junge Generation. Kinder und Jugendliche wolle man nicht nur erreichen, sondern ernst nehmen, fordern und ihnen echte Erfahrungen ermöglichen. Ob Kinderbiennale, mobile Bühnen, haptische Erfahrungsräume oder neue Formate jenseits von Schule und Familie – entscheidend sei echte Begegnung.
Zudem müsse Kultur sich selbst verändern, um relevant zu bleiben: Orte der Beteiligung, offenen Debatte und Gemeinschaft. Erst wenn Einrichtungen authentisch im Dialog mit der Gesellschaft stehen, entstehen auch stabile, langfristige Beziehungen zu Förderern.
Kunstfreiheit sichern, Beziehungen pflegen
Partnerschaften mit privaten Gelgebern ja, aber zu welchem Preis? Sponsoren dürfen niemals Einfluss auf das Programm ausüben, war sich das Panel einig. Für Hammer sei der Respekt vor der Kunstfreiheit das „oberstes Gebot“, Ackermann betonte dieselbe Linie, und auch Vogel verwies auf die Verantwortung, Autonomie zu bewahren.
Gleichzeitig herrschte Einigkeit darüber, dass Fundraising eine Leitungsaufgabe ist. Es braucht keine großen Sponsoringabteilungen, sondern Vertrauen – über Jahre aufgebaut. „Beziehungsbildung ist Chefsache“, formulierte Hammer. Ein Satz, der zum Leitmotiv des Abends wurde.
Standortfaktoren und kulturelle Erfahrung
Auch die Frage nach der Attraktivität des Kulturstandorts spielt bei der Akquise von privaten Partnern eine große Rolle. Salzburg punktet mit touristischem Gesamtpaket, während Berlin mit internationaler Strahlkraft beeindruckt, aber unter praktischen Hürden leidet – Prof. Ackermann verwies etwa auf die mangelnde internationale Anbindung des Berliner Flughafens.
Fazit: Gemeinsam Verantwortung übernehmen
Der Abend machte deutlich, dass die Herausforderungen groß sind – doch ebenso groß ist die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Kultur braucht Staat und Privatwirtschaft, braucht Menschen, die sich engagieren, und Institutionen, die mutig vorangehen. Oder wie Johannes Vogel es auf den Punkt brachte: „Wir müssen relevanter für die Gesellschaft werden. Dann kommt auch die Politik nicht an uns vorbei.“