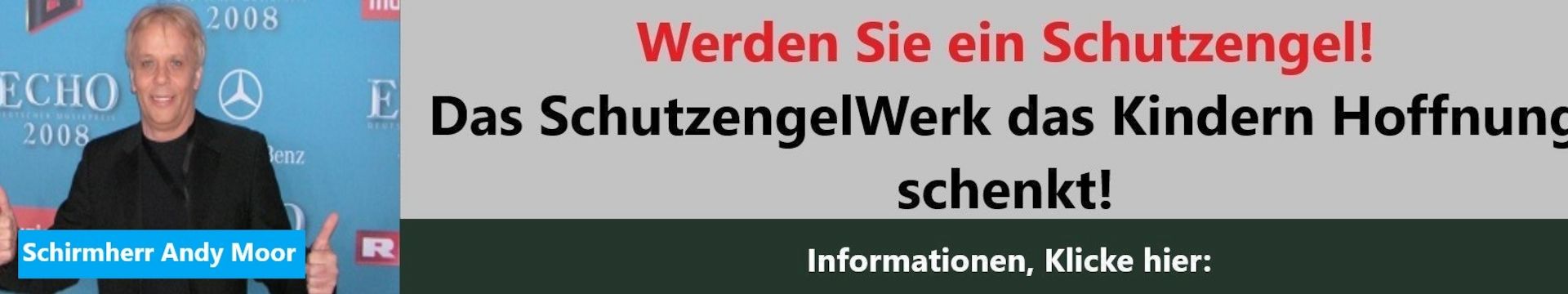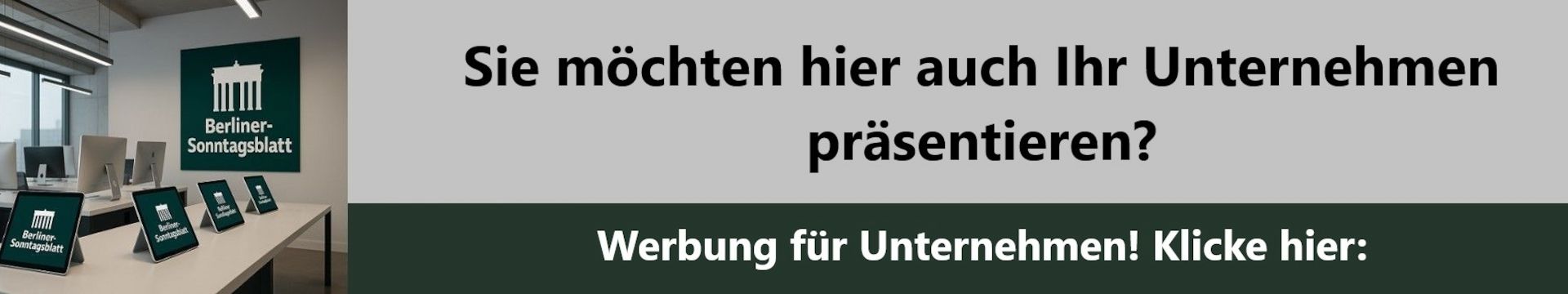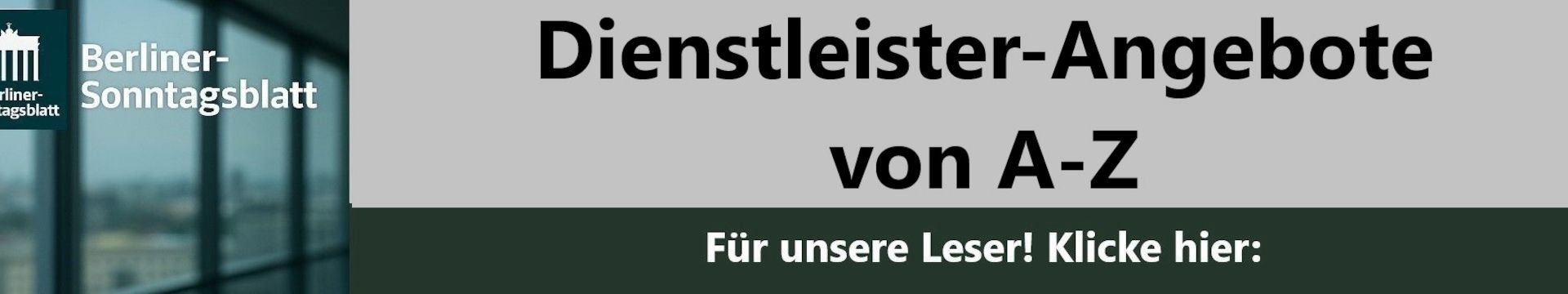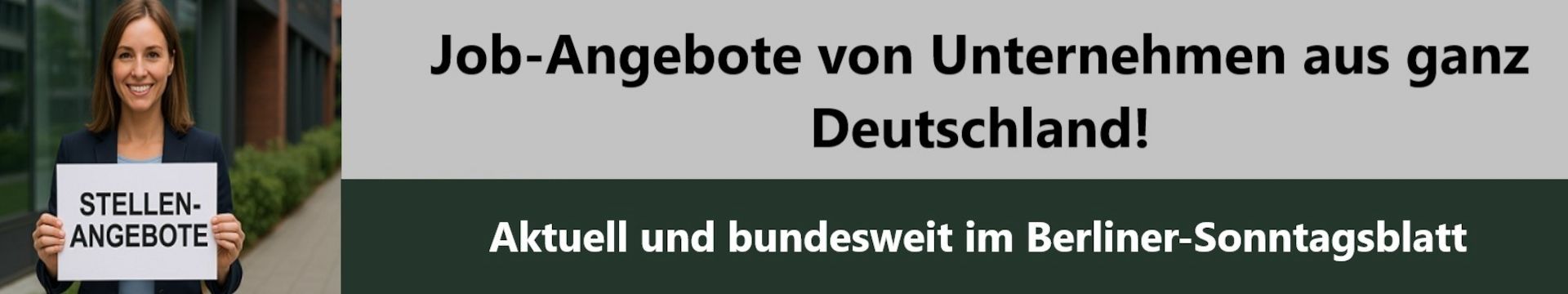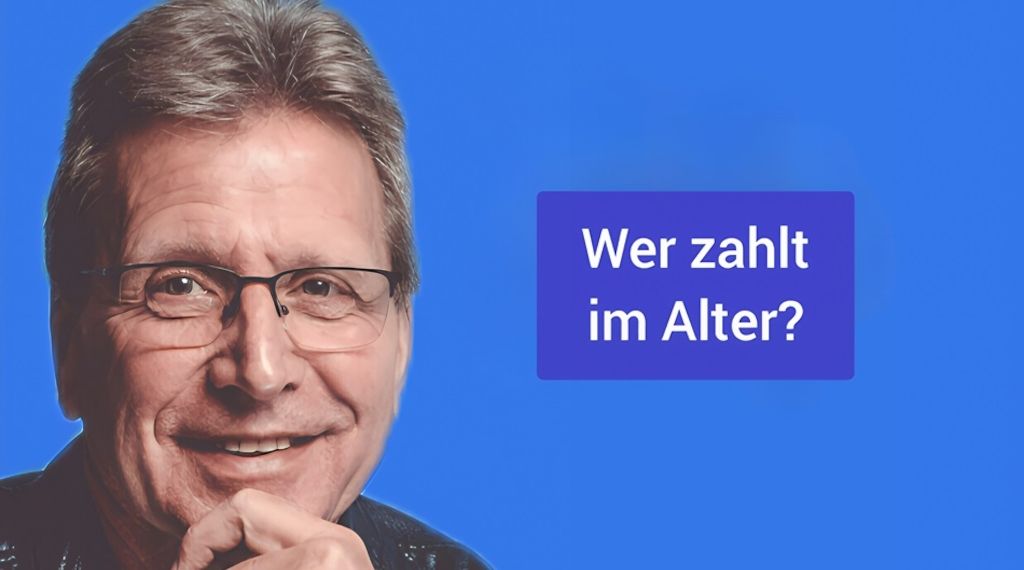Als die Bundesrepublik 1957 die große Rentenreform einführte, war das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) groß. Wer arbeitete, zahlte ein – und bekam später eine Rente. Die sogenannte „dynamische Rente“ sollte nicht nur Altersarmut verhindern, sondern auch am Wohlstand teilhaben lassen. Doch schon damals war klar: Die Gesellschaft verändert sich. Die Menschen leben länger, Familienstrukturen wandeln sich, Erwerbsbiografien werden vielfältiger. Was damals noch als ferne Zukunft galt, ist heute Realität.
Was man 1957 wusste – und was nicht
Die demografischen Grundlagen waren 1957 stabil: Die Geburtenraten waren hoch, die Lebenserwartung lag bei etwa 66 Jahren für Männer und 71 Jahren für Frauen. Der Anteil der über 65-Jährigen betrug unter zehn Prozent. Die Rentenbezugsdauer war kurz, das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern günstig – etwa vier zu eins.
Zwar war bekannt, dass die Lebenserwartung steigen würde, doch die langfristigen Folgen für das Rentensystem wurden unterschätzt. Die Rentenreform von 1957 setzte auf wirtschaftliches Wachstum, Vollbeschäftigung und den Generationenvertrag – nicht auf Kapitaldeckung oder ergänzende Vorsorgeformen.
Erst in den 1970er Jahren, mit dem Geburtenrückgang nach dem „Pillenknick“, wurde deutlich, dass das Umlagesystem langfristig an seine Grenzen stoßen könnte.
Die Geburt der Drei-Säulen-Theorie
Ende der 1970er Jahre begannen Versicherungsexperten und Ökonomen, ein neues Modell zu skizzieren: Die Altersvorsorge sollte auf drei Säulen stehen – gesetzlich, betrieblich und privat. Die Idee kam aus der Versicherungswirtschaft und wurde international diskutiert, etwa durch die OECD. In Deutschland wurde sie ab 2001 politisch umgesetzt: Mit der Riester-Rente und später der Rürup-Rente wurde die Theorie zur Praxis.
Warum drei Säulen?
Die gesetzliche Rente basiert auf dem Umlageverfahren: Die Beiträge der Erwerbstätigen finanzieren die laufenden Renten. Doch der demografische Wandel verändert alles. 1957 kamen auf 100 Rentner noch 373 Beitragszahler. Im Jahr 2023 waren es nur noch 220, und für 2045 wird ein Verhältnis von 174 zu 100 prognostiziert. Auch das Rentenniveau sinkt: Von 52,9 Prozent im Jahr 2002 auf 48,0 Prozent im Jahr 2024 – mit einer erwarteten weiteren Absenkung auf rund 45 Prozent bis 2037.
Die zweite Säule – die betriebliche Altersversorgung – und die dritte Säule – die private Vorsorge – sollen helfen, diese Lücke zu schließen. Sie sind keine Konkurrenz zur GRV, sondern eine notwendige Ergänzung. Die Drei-Säulen-Theorie ist kein politisches Wunschdenken, sondern eine wirtschaftlich begründete Antwort auf demografische Realitäten. Sie wurde nicht erfunden, um die gesetzliche Rente zu schwächen – sondern um sie zu stützen.
Wer heute über Rente spricht, sollte alle drei Säulen im Blick behalten – und ihre Geschichte kennen.
Im nächsten Artikel: Wie sich die gesetzliche Rentenversicherung seit 1957 entwickelt hat – mit Zahlen, Zuschüssen, rentenfremden Leistungen und der Frage: Wer zahlt eigentlich was?