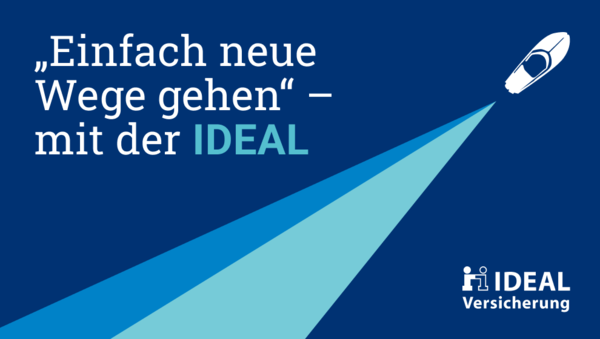Die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) war nie nur eine Kasse für Altersbezüge. Seit ihrer Reform 1957 ist sie ein Spiegel gesellschaftlicher Erwartungen, wirtschaftlicher Entwicklungen und politischer Entscheidungen. Wer verstehen will, warum heute fast ein Viertel des Bundeshaushalts in die Rentenkasse fließt, muss zurückblicken – auf Beitragssätze, Zuschüsse, Sonderlasten und die demografische Realität.
1957: Der Generationenvertrag als Versprechen
Mit der Rentenreform 1957 wurde die „dynamische Rente“ eingeführt. Die Beiträge der Erwerbstätigen sollten die laufenden Renten finanzieren – ein Umlageverfahren, getragen von Vertrauen in Wachstum und Vollbeschäftigung.
• Beitragssatz: 14 %
• Einnahmen: ca. 5 Mrd. DM
• Rentenzahlungen: ca. 4,5 Mrd. DM
• Bundeszuschuss: rund 24 % der Einnahmen
• Rentenfremde Leistungen: kaum relevant
• Beitragszahler pro Rentner: ca. 4:1
• Lebenserwartung: Männer 66 Jahre, Frauen 71 Jahre
• Rentenbezugsdauer: durchschnittlich 5–7 Jahre
Die GRV war nahezu vollständig beitragsfinanziert. Die demografische Lage war günstig, die Rentenbezugsdauer kurz, die Erwerbsquote hoch.
1990er: Einheit, Sonderlasten, Systembruch
Mit der Wiedervereinigung übernahm die GRV auch die Rentenansprüche aus der DDR. Die sogenannten Ostrenten wurden über das AAÜG in das westdeutsche System integriert – mit Sonderregelungen, höheren Entgeltpunkten und Übergangsregelungen.
• Beitragssatz: 17,7 % (1992)
• Einnahmen: ca. 120 Mrd. DM
• Rentenzahlungen: ca. 110 Mrd. DM
• Bundeszuschuss: ca. 30 Mrd. DM (ca. 25 %)
• Rentenfremde Leistungen: erstmals relevant – u. a. Ausbildungszeiten, Reha, KVdR
• Anteil Ostrenten: bis zu 30 % der Rentenzahlungen
• Beitragszahler pro Rentner: ca. 2,5:1
• Lebenserwartung: Männer 73 Jahre, Frauen 79 Jahre
• Rentenbezugsdauer: 12–15 Jahre
Die GRV wurde zur politischen Ausgleichskasse – ohne dass alle Leistungen steuerfinanziert wurden. Die steigende Lebenserwartung verlängerte die Rentenphase deutlich.
2024: Ein System unter Druck
• Beitragssatz: 18,6 %
• Gesamteinnahmen: ca. 397 Mrd. €
• Beiträge: 305 Mrd. € (77 %)
• Bundeszuschüsse: 87,7 Mrd. € (22 %)
• Gesamtausgaben: ca. 397 Mrd. €
• Rentenzahlungen: 344 Mrd. € (87 %)
• Rentenfremde Leistungen: ca. 40–45 Mrd. €
• Anteil Ostrenten: weiterhin rund 20 %
• Beitragszahler pro Rentner: ca. 2,2:1
• Lebenserwartung: Männer 79 Jahre, Frauen 83 Jahre
• Rentenbezugsdauer: 18–22 Jahre
• Anteil der Rentenmittel am Bundeshaushalt: 24,6 %
Die demografische Entwicklung ist der zentrale Belastungsfaktor: Weniger Beitragszahler, längere Rentenbezugsdauer, steigende Ansprüche. Die GRV muss heute deutlich mehr leisten – mit weniger Beitragsbasis.
Die stille Verschiebung
Was 1957 als beitragsfinanzierte Versicherung begann, ist heute ein hybrides System mit sozialpolitischer Steuerungsfunktion. Die GRV zahlt nicht nur Rente – sie gleicht Lebensläufe aus, erfüllt gesellschaftliche Erwartungen und trägt historische Lasten. Doch das hat seinen Preis: Die Abhängigkeit vom Bundeshaushalt wächst, und mit ihr die politische Angreifbarkeit. Wer über Rentenreformen spricht, muss auch über Steuern, Zuschüsse und Demografie reden.
Im nächsten Artikel: Die betriebliche Altersversorgung – Geschichte, Modelle, Förderlogik und warum sie oft unterschätzt wird.
Quellen:
– Deutsche Rentenversicherung Bund: Rentenversicherung in Zahlen 2024
– Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Sozialbericht 2024
– Sozialpolitik Aktuell: Entwicklung der Bundesmittel zur GRV 1957–2024
– Statistisches Bundesamt: Bevölkerung, Lebenserwartung, Rentenbezugsdauer
– bpb: Rentenpolitik und demografischer Wandel
– Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Jahresgutachten 2023/24
Lesen Sie auch den ersten Artikel von Alfred Hammp" Was bleibt im Alter", klicke hier